
| 1. |  König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1155 in Königstädtel ? (Sohn von Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) und Judith von Thüringen); gestorben am 15 Dez 1230. König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1155 in Königstädtel ? (Sohn von Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) und Judith von Thüringen); gestorben am 15 Dez 1230. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_I._Přemysl (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Adelheid von Meissen. Adelheid (Tochter von Markgraf Otto von Meissen (Wettiner) und Markgräfin Hedwig von Brandenburg (von Ballenstedt)) wurde geboren in nach 1160; gestorben am 2 Feb 1211 in Meissen, Sachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: Adelheid hatte mit Ottokar I. je nach Quelle drei, vier Kinder.Kinder:
Familie/Ehepartner: Konstanze von Ungarn. Konstanze (Tochter von König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Agnès von Châtillon) wurde geboren in zw 1177 und 1181; gestorben am 04/05 Dez 1240 in Předklášteří. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: Mit Konstanze hatte er je nach Quelle weitere acht, neun Kinder:Kinder:
|
| 2. |  Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?)); gestorben am 18 Jan 1174 in Meerane. Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1110 (Sohn von Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?)); gestorben am 18 Jan 1174 in Meerane. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II. (Okt 2017) Vladislav heiratete Judith von Thüringen in 1153. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Judith von Thüringen (Tochter von Landgraf Ludwig I. von Thüringen (von Schauenburg) und Hedwig von Gudensberg). Notizen: Judith hatte mit Vladislav II. drei Kinder. Notizen: Mit Judith hatte Vladislav II. die Kinder:
|
| 4. |  Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1070 (Sohn von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Königin Swatawa von Polen); gestorben am 12 Apr 1125. Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in cir 1070 (Sohn von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Königin Swatawa von Polen); gestorben am 12 Apr 1125. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_I. (Okt 2017) Vladislav + Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. |  Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?) (Tochter von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)). Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?) (Tochter von Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) und Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg)). Notizen: Rixa hatte mit Vladislav I. vier Kinder. Notizen: Richenza und Vladislav I. hatten die Kinder:
|
| 6. |  Landgraf Ludwig I. von Thüringen (von Schauenburg) (Sohn von Graf Ludwig von Schauenburg (Ludowinger) und Adelheid von Stade); gestorben am 12 Jan 1140; wurde beigesetzt in Kloster Reinhardsbrunn. Landgraf Ludwig I. von Thüringen (von Schauenburg) (Sohn von Graf Ludwig von Schauenburg (Ludowinger) und Adelheid von Stade); gestorben am 12 Jan 1140; wurde beigesetzt in Kloster Reinhardsbrunn. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Thüringen) Ludwig heiratete Hedwig von Gudensberg in 1110. Hedwig wurde geboren in 1098; gestorben in 1148. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Hedwig von Gudensberg wurde geboren in 1098; gestorben in 1148. Notizen: Erbtochter von Giso IV.
|
| 8. | 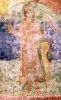 König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in 1035 (Sohn von Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Herzogin Judith von Schweinfurt); gestorben am 14 Jan 1092. König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) wurde geboren in 1035 (Sohn von Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) und Herzogin Judith von Schweinfurt); gestorben am 14 Jan 1092. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II. (Okt 2017) Vratislaw heiratete Königin Swatawa von Polen in 1062. Swatawa (Tochter von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew) wurde geboren in vor 1050; gestorben am 1 Sep 1126. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | 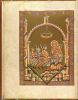 Königin Swatawa von Polen wurde geboren in vor 1050 (Tochter von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew); gestorben am 1 Sep 1126. Königin Swatawa von Polen wurde geboren in vor 1050 (Tochter von Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) und Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew); gestorben am 1 Sep 1126. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Swatawa war die erste böhmische Königin. Notizen: Aus zweiter Ehe mit Swatawa von Polen hinterließ Vratislaw vier Söhne, die nach dem Tod des Vaters sofort um die Nachfolge zu kämpfen begannen, und eine Tochter in wahrscheinlich dieser Reihenfolge:
|
| 10. |  Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) (Sohn von Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)); gestorben am 11 Dez 1127?. Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?) (Sohn von Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)); gestorben am 11 Dez 1127?. Anderer Ereignisse und Attribute:
Heinrich + Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. |  Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) (Tochter von Diepold II. von Vohburg (von Giengen) und Liutgard von Zähringen). Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) (Tochter von Diepold II. von Vohburg (von Giengen) und Liutgard von Zähringen). Notizen: Name:
|
| 12. |  Graf Ludwig von Schauenburg (Ludowinger) wurde geboren in 1042 (Sohn von Ludwig von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger), der Bärtige und Cäcilie von Sangerhausen); gestorben in 06 / 08 Mai 1123 in Reinhardsbrunn. Graf Ludwig von Schauenburg (Ludowinger) wurde geboren in 1042 (Sohn von Ludwig von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger), der Bärtige und Cäcilie von Sangerhausen); gestorben in 06 / 08 Mai 1123 in Reinhardsbrunn. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Springer Ludwig + Adelheid von Stade. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. |  Adelheid von Stade Adelheid von StadeNotizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Stade Notizen: Die wahrscheinlichen Kinder von Ludwig und Adelheid sind:
|
| 16. |  Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) (Sohn von Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) und Božena (Beatrice)); gestorben am 10 Jan 1055 in Chrudim; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prag. Herzog Břetislav I. von Böhmen (Přemysliden) (Sohn von Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) und Božena (Beatrice)); gestorben am 10 Jan 1055 in Chrudim; wurde beigesetzt in Veitsdom, Prag. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Břetislav_I. (Okt 2017) Břetislav heiratete Herzogin Judith von Schweinfurt in zw 1021 und 1029 in Olmütz. Judith (Tochter von Markgraf Heinrich von Schweinfurt und Gräfin Gerberga in der Wetterau) wurde geboren in 1003; gestorben am 2 Aug 1058 in Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. |  Herzogin Judith von Schweinfurt wurde geboren in 1003 (Tochter von Markgraf Heinrich von Schweinfurt und Gräfin Gerberga in der Wetterau); gestorben am 2 Aug 1058 in Ungarn. Herzogin Judith von Schweinfurt wurde geboren in 1003 (Tochter von Markgraf Heinrich von Schweinfurt und Gräfin Gerberga in der Wetterau); gestorben am 2 Aug 1058 in Ungarn. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Judith und Břetislav I. hatten fünf Söhne.
|
| 18. |  Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) wurde geboren am 28 Jul 1016 (Sohn von König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) und Pfalzgräfin Richenza von Lothringen); gestorben am 28 Okt 1058. Fürst Kasimir I. von Polen (Piasten) wurde geboren am 28 Jul 1016 (Sohn von König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) und Pfalzgräfin Richenza von Lothringen); gestorben am 28 Okt 1058. Notizen: Genannt Odnowiciel (= der Erzerneuerer) Kasimir heiratete Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew in 1043. Dobronega gestorben in 1087. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. |  Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew gestorben in 1087. Prinzessin Dobronega (Maria) von Kiew gestorben in 1087. Notizen: Als Vater kommen in Frage
|
| 20. |  Graf Poppo von Berg (Schelklingen?) Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)
|
| 22. |  Diepold II. von Vohburg (von Giengen) (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)); gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. Diepold II. von Vohburg (von Giengen) (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)); gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_II._von_Vohburg Diepold + Liutgard von Zähringen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. |  Liutgard von Zähringen (Tochter von Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige und Gräfin Richwara (von Lothringen) ?). Liutgard von Zähringen (Tochter von Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige und Gräfin Richwara (von Lothringen) ?). Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liutgard_von_Zähringen_(Tochter_Berthold_I.)
|
| 24. |  Ludwig von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger), der Bärtige gestorben am 1056 oder 1080; wurde beigesetzt in Stift St. Alban vor Mainz. Ludwig von Thüringen (von Schauenburg) (Ludowinger), der Bärtige gestorben am 1056 oder 1080; wurde beigesetzt in Stift St. Alban vor Mainz. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Bärtige Ludwig heiratete Cäcilie von Sangerhausen in cir 1039. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sangerhausen Notizen: Kinder von Ludwig und Cäcilie sind nach der unglaubwürdigen Reinhardsbrunner Chronik:
|
| 32. |  Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) (Sohn von Herzog Boleslaw II. von Böhmen (Přemysliden) und Hemma); gestorben am 9 Nov 1034. Herzog Oldřich (Ulrich) von Böhmen (Přemysliden) (Sohn von Herzog Boleslaw II. von Böhmen (Přemysliden) und Hemma); gestorben am 9 Nov 1034. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Oldřich (Apr 2018) Oldřich + Božena (Beatrice). Božena gestorben in 1052. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. |  Božena (Beatrice) gestorben in 1052. Božena (Beatrice) gestorben in 1052. Notizen: Verheiratet:
|
| 34. |  Markgraf Heinrich von Schweinfurt wurde geboren in vor 980 (Sohn von Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt und Gräfin Eilika von Walbeck); gestorben am 18 Sep 1017. Markgraf Heinrich von Schweinfurt wurde geboren in vor 980 (Sohn von Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt und Gräfin Eilika von Walbeck); gestorben am 18 Sep 1017. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Schweinfurt Heinrich heiratete Gräfin Gerberga in der Wetterau in vor 1003. Gerberga (Tochter von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)) wurde geboren in cir 960; gestorben in cir 1036. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | 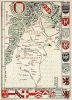 Gräfin Gerberga in der Wetterau wurde geboren in cir 960 (Tochter von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)); gestorben in cir 1036. Gräfin Gerberga in der Wetterau wurde geboren in cir 960 (Tochter von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)); gestorben in cir 1036. Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Notizen: Das Ehepaar hatte mehrere Kinder, darunter vier namentlich bekannte:
|
| 36. |  König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) wurde geboren in 990 (Sohn von König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) und Prinzessin Eminilde von Westslawien); gestorben am 25 Mrz 1034. König Miezislaus II. (Mieszko) von Polen (Piasten) wurde geboren in 990 (Sohn von König Boleslaus I. (Boleslaw) von Polen (Piasten) und Prinzessin Eminilde von Westslawien); gestorben am 25 Mrz 1034. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II._Lambert Miezislaus heiratete Pfalzgräfin Richenza von Lothringen in 1013. Richenza (Tochter von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland) wurde geboren in cir 1000; gestorben am 23 Mrz 1063. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. |  Pfalzgräfin Richenza von Lothringen wurde geboren in cir 1000 (Tochter von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland); gestorben am 23 Mrz 1063. Pfalzgräfin Richenza von Lothringen wurde geboren in cir 1000 (Tochter von Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und Prinzessin Mathilde von Deutschland); gestorben am 23 Mrz 1063. Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richeza_(Polen)
|
| 44. |  Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen) (Sohn von Graf Rapoto II. im Traungau (Rapotonen) und (Hupaldinger)); gestorben in 18 Mai 1060?. Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen) (Sohn von Graf Rapoto II. im Traungau (Rapotonen) und (Hupaldinger)); gestorben in 18 Mai 1060?. Notizen: Name:
|
| 46. |  Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige wurde geboren in cir 1000 (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)); gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige wurde geboren in cir 1000 (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)); gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_I._(Zähringen) Berchtold + Gräfin Richwara (von Lothringen) ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 47. |  Gräfin Richwara (von Lothringen) ? (Tochter von Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen und von Kärnten (Salier) ?). Gräfin Richwara (von Lothringen) ? (Tochter von Pfalzgraf Heinrich (Hezzelin) von Lothringen und von Kärnten (Salier) ?). Notizen: Name: Notizen: Die beiden hatten fünf bekannte Kinder:
|