
| 1. |  Gräfin Richwara (von Lothringen) ? Gräfin Richwara (von Lothringen) ?Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Herzog Berchtold I. von Kärnten (von Zähringen), der Bärtige . Berchtold (Sohn von Graf Berchtold (Bezzelin) im Breisgau (der Ortenau) und Gräfin Liutgard? (Habsburger)) wurde geboren in cir 1000; gestorben in zw 5 und 6 Nov 1078 in Weilheim an der Teck; wurde beigesetzt in Kloster Hirsau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Stammvater der Linie der Markgrafen von Baden. Familie/Ehepartner: Judith. Judith gestorben in 1091 in Salerno, Kampanien, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |  Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) II. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_II,_Duke_of_Swabia Berthold heiratete Herzogin Agnes von Rheinfelden in 1079. Agnes (Tochter von Herzog Rudolf von Rheinfelden (von Schwaben) und Herzogin Adelheid von Turin (von Maurienne)) wurde geboren in cir 1065 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 19 Dez 1111; wurde beigesetzt in Kloster St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liutgard_von_Zähringen_(Tochter_Berthold_I.) Familie/Ehepartner: Diepold II. von Vohburg (von Giengen). Diepold (Sohn von Graf Diepold I. im Augstgau (Rapotonen)) gestorben am 7 Aug 1078 in Mellrichstadt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Ernst I. von Grögling. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. |  Richinza von Zähringen Richinza von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Rudolf ? von Frickingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Ludwig I. von Sigmaringen, der Ältere . Ludwig gestorben in vor 1092. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |  Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Markgraf Hermann II. von Baden (von Verona) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Markgraf Hermann II. von Baden (* um 1060; † 7. Oktober 1130) begründete erstmals den Titel Markgraf von Baden durch die Titulierung nach dem neuen Herrschaftszentrum auf Burg Hohenbaden (Altes Schloss) in der heutigen Stadt Baden-Baden. Hermann heiratete Judith von Backnang (Hessonen) in cir 1111. Judith (Tochter von Hesso II. von Backnang (Hessonen), der Jüngere und Judith) wurde geboren in cir 1080; gestorben in cir 1123 in Backnang, Baden-Württemberg, DE ; wurde beigesetzt in Grablege im Augustiner-Chorherrenstift in Backnang. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Luitgard von Breisgau |
| 8. |  Graf Rudolf II. von Zähringen Graf Rudolf II. von Zähringen |
| 9. |  Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) III. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_III._(Zähringen) Familie/Ehepartner: Sofie von Bayern (Welfen). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. |  Herzog Konrad I. von Zähringen Herzog Konrad I. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Duke_of_Z%C3%A4hringen Konrad heiratete Clementia von Namur in cir 1130. Clementia (Tochter von Gottfried von Namur und Ermensinde von Luxemburg) wurde geboren in cir 1110; gestorben am 28 Dez 1158; wurde beigesetzt in St. Peter im Schwarzwald. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen |
| 12. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen |
| 13. |  Petrissa von Zähringen Petrissa von Zähringen Petrissa heiratete Graf Friedrich I. von Bar-Mümpelgard (von Pfirt) in 1111. Friedrich (Sohn von Graf Dietrich I. von Mousson-Scarponnois und Gräfin Ermentrud von Burgund) gestorben in Aug 1160. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. |  Liutgard von Zähringen Liutgard von Zähringen Familie/Ehepartner: Gottfried II. von Calw. Gottfried (Sohn von Graf Adalbert II. von Calw und Wiltrud von Niederlothringen) wurde geboren in cir 1060; gestorben am 6 Feb 1131. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |  Judith von Zähringen Judith von Zähringen Familie/Ehepartner: Graf Ulrich II. von Gammertingen (Gammertinger). Ulrich (Sohn von Graf Ulrich I. von Gammertingen (Gammertinger) und Adelheid von Kyburg (von Dillingen)) gestorben am 18 Sep 1150 in Kloster Zwiefalten, Zwiefalten, Reutlingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Judith heiratete Egino von Zollern-Urach in Datum unbekannt. Egino (Sohn von Graf Friedrich I. von Zollern und Udilhild von Urach) wurde geboren in cir 1098; gestorben in nach 1134. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. |  Diepold III. von Vohburg Diepold III. von Vohburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Diepold III. von Vohburg Diepold heiratete Adelajda (Adelheid) von Polen in vor 1118. Adelajda (Tochter von Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) und Judith (Salier)) wurde geboren in 1090/91; gestorben in 1127. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Kunigunde von Beichlingen. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Sophia von Ungarn. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. |  Konrad von Württemberg (von Giengen) Konrad von Württemberg (von Giengen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Giengen_an_der_Brenz Familie/Ehepartner: Hedwig von Spitzenberg-Sigmatingen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Werntrud. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. |  Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Gräfin Adelheid von Mochental (von Vohburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Berg (Schelklingen?). Heinrich (Sohn von Graf Poppo von Berg (Schelklingen?)) gestorben am 11 Dez 1127?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Ludwig II. von Sigmaringen (von Spitzenberg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. |  Markgraf Hermann III von Baden, der Grosse Markgraf Hermann III von Baden, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Markgraf Hermann III. von Baden, genannt der Große, (* um 1105; † 16. Januar 1160) war Markgraf von Verona und Baden. Hermann heiratete Bertha in vor 1134. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. |  Judith von Baden (von Verona) Judith von Baden (von Verona) Familie/Ehepartner: Herzog Ulrich I. von Kärnten (Spanheimer). Ulrich (Sohn von Engelbert II. von Spanheim (von Kärnten) und Uta von Passau) gestorben am 7 Apr 1144; wurde beigesetzt in Kloster Rosazzo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. |  Konrad von Zähringen Konrad von Zähringen |
| 23. |  Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen Herzog Berthold (Berchtold) IV. von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen:
Berthold heiratete Gräfin Heilwig von Froburg (Frohburg) in 1183. Heilwig (Tochter von Volmar II. von Froburg (Frohburg)) gestorben in cir 1183. [Familienblatt] [Familientafel]
Berthold heiratete Gräfin Ida von Elsass in 1183. Ida (Tochter von Graf Matthäus von Elsass (von Flandern) und Gräfin Maria von Boulogne (von Blois)) wurde geboren in 1160/61; gestorben am 21 Apr 1216. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |  Clementina von Zähringen Clementina von Zähringen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Clementia_of_Z%C3%A4hringen Clementina heiratete Herzog Heinrich von Sachsen (von Bayern) (Welfen), der Löwe in 1148, und geschieden in 1162. Heinrich (Sohn von Heinrich Welf (von Bayern), der Stolze und Gertrud (Gertraud) von Sachsen (von Süpplingenburg)) wurde geboren in cir 1129 / 1130; gestorben am 6 Aug 1195 in Braunschweig; wurde beigesetzt in Braunschweiger Dom (Blasius-Kirche), Braunschweig. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Graf Humbert III. von Savoyen (von Maurienne). Humbert (Sohn von Graf Amadeus III. von Savoyen (Maurienne) und Mathilde von Albon) wurde geboren am 1 Aug 1136; gestorben am 4 Mai 1188 in Veillane. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_I._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | R. von Zähringen |
| 27. | Herzog Hugo von Zähringen (von Ullenburg) |
| 28. |  Uta von Schauenburg (von Calw) Uta von Schauenburg (von Calw) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Uta_von_Schauenburg Familie/Ehepartner: Markgraf Welf VI. (Welfen). Welf (Sohn von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) wurde geboren in 1115; gestorben am 15 Dez 1191 in Memmingen, Schwaben, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Kloster Steingaden in der Klosterkirche St. Johannes Baptist. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. |  Graf Ulrich III. von Gammertingen (Gammertinger) Graf Ulrich III. von Gammertingen (Gammertinger) Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Adelheid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. |  Luithold von Aichelberg (Zollern-Urach) Luithold von Aichelberg (Zollern-Urach) Luithold heiratete Ne von Otterswang in Datum unbekannt. Ne (Tochter von Mangold von Otterswang) wurde geboren in 1145 in Otterswang, Oberschwaben, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. |  Markgraf Diepold IV. von Vohburg Markgraf Diepold IV. von Vohburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Mathilde von Bayern (Welfen). Mathilde (Tochter von Herzog Heinrich IX. von Bayern (Welfen), der Schwarze und Wulfhild von Sachsen) gestorben am 16 Mrz 1183. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. |  Luitkart (Sophia?)) von Vohburg Luitkart (Sophia?)) von Vohburg Familie/Ehepartner: Graf Volkrat (Volkrad) von Lechsgemünd. Volkrat (Sohn von Graf Heinrich II. von Lechsgemünd und Liutkard) gestorben in cir 1160. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. |  Euphemia von Vohburg Euphemia von Vohburg |
| 34. |  Adela von Vohburg Adela von Vohburg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Erbin des Egerlandes Adela heiratete Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) von Schwaben (von Staufen) in vor 2 Mrz 1147 in Eger, Böhmen, Tschechien, und geschieden in Mrz 1153 in Konstanz, Baden, DE. Friedrich (Sohn von Herzog Friedrich II. von Schwaben (Staufer) und Herzogin Judith Welf (von Bayern)) wurde geboren in cir 1122; gestorben am 10 Jun 1190 in im Fluss Saleph nahe Seleucia, Kleinarmenien. [Familienblatt] [Familientafel] Adela heiratete Dietho von Ravensburg in 1153/1154. Dietho wurde geboren in cir 1130; gestorben in nach 1187. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. |  Judith (Jutta) von Vohburg Judith (Jutta) von Vohburg |
| 36. |  Graf Ludwig von Württemberg Graf Ludwig von Württemberg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Württemberg Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. |  Gräfin Salome von Berg (Schelklingen?) Gräfin Salome von Berg (Schelklingen?) Notizen: Salome hatte mit Bolesław III. 14 Kinder. Salome heiratete Herzog Boleslaw III. von Polen (Piasten), Schiefmund in 1115. Boleslaw (Sohn von Fürst Władysław I. (Hermann) von Polen (Piasten) und Prinzessin Judith von Böhmen) wurde geboren am 20 Aug 1085 in Krakau, Polen; gestorben am 28 Okt 1138 in Sochaczew, Polen ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. |  Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?) Rixa (Richenza) von Berg (Schelklingen?) Notizen: Rixa hatte mit Vladislav I. vier Kinder. Familie/Ehepartner: Fürst Vladislav I. von Böhmen (Přemysliden). Vladislav (Sohn von König Vratislaw II. (Wratislaw) von Böhmen (Přemysliden) und Königin Swatawa von Polen) wurde geboren in cir 1070; gestorben am 12 Apr 1125. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. |  Graf Diepold von Berg-Schelklingen Graf Diepold von Berg-Schelklingen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Gisela von Andechs (von Diessen). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. |  Graf Rudolf von Sigmaringen (von Spitzenberg) Graf Rudolf von Sigmaringen (von Spitzenberg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Sigmaringen#Geschichte Familie/Ehepartner: Adelheid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. |  Markgraf Hermann IV von Baden Markgraf Hermann IV von Baden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_IV._(Baden) Hermann heiratete Markgräfin Bertha von Tübingen in cir 1162. Bertha gestorben am 24 Feb 1169; wurde beigesetzt in Grabgelege der Markgrafen von Baden im Augustiner-Chorherrenstift in Backnang. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. |  Herzog Hermann II. von Kärnten Herzog Hermann II. von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_(Kärnten) (Apr 2018) Hermann heiratete Herzogin Agnes von Österreich (Babenberger) in 1173. Agnes (Tochter von Herzog Heinrich II. von Österreich, Jasomirgott und Theodora Komnena (Byzanz, Komnenen)) wurde geboren in 1151; gestorben am 13 Jan 1182; wurde beigesetzt in Krypta der Wiener Schottenkirche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. |  Herzog Berthold V. von Zähringen Herzog Berthold V. von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_V._(Zähringen) Berthold heiratete Clementia von Auxonne in 1212. Clementia (Tochter von Graf Stephan III. von Auxonne (von Chalon) und Beatrix von Chalon (Thiern)) wurde geboren in cir 1189; gestorben in nach 1235. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. |  Agnes von Zähringen Agnes von Zähringen Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Agnes heiratete Graf Egino IV. von Urach, der Bärtige in cir 1177. Egino (Sohn von Egino III. von Urach und Kunigunde von Wasserburg (Andechs)) wurde geboren in cir 1160 in Urach, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 12 Jan 1230 in Tennenbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. |  Anna von Zähringen Anna von Zähringen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Zähringen Anna heiratete Graf Ulrich III. von Kyburg in zw 1180 und 1181. Ulrich (Sohn von Graf Hartmann III. von Kyburg und Gräfin Richenza von Lenzburg-Baden) gestorben in 1227. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. |  Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) Königin Gertrud von Bayern (von Sachsen) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_(Bayern_und_Sachsen) Gertrud heiratete Friedrich IV. von Schwaben in 1166. Friedrich (Sohn von König Konrad III. von Hohenstaufen (von Schwaben) (von Büren) und Gertrud von Sulzbach) wurde geboren am 1144 / 1145; gestorben am 19 Aug 1167 in Rom, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] Gertrud heiratete Knut VI. von Dänemark in 1177. Knut (Sohn von König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse und Königin Sophia von Dänemark (von Minsk)) wurde geboren in cir 1162; gestorben in 1202; wurde beigesetzt in St.-Bendts-Kirche, Ringsted. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 47. |  Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck Herzog Adalbert II. (Albrecht) von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_II._(Teck) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. |  Elisabeth (Welfen) Elisabeth (Welfen) Elisabeth heiratete Rudolf von Pfullendorf-Bregenz in cir 1150. Rudolf (Sohn von Ulrich von Ramsberg und Adelheid von Bregenz) wurde geboren in ca 1100/1110; gestorben am 9 Jan 1181 in Jerusalem. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. |  Graf Welf VII. (Welfen) Graf Welf VII. (Welfen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Welf_VII. |
| 50. |  Udihild von Gammertingen Udihild von Gammertingen Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Markgraf Heinrich von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. |  Wilipirg von Aichelberg Wilipirg von Aichelberg Wilipirg heiratete Graf Burkhard IV. von Hohenberg in cir 1200. Burkhard (Sohn von Graf Burkhard III. von Hohenberg und Kunigunde von Grünberg) gestorben in 1217/25. [Familienblatt] [Familientafel]
Wilipirg heiratete Graf Diepold von Kersch (von Berg) in Datum unbekannt. Diepold (Sohn von Graf Ulrich von Berg und Adelheid (Udelhild) von Ronsberg) wurde geboren in cir 1160; gestorben in cir 1220. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. |  Graf Diepold von Lechsgemünd Graf Diepold von Lechsgemünd Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_von_Lechsgemünd-Graisbach Familie/Ehepartner: Agathe von Teck (von Öttingen ?). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Heinrich IV. von Lechsgemünd Familie/Ehepartner: Willibirg von Treffen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 54. |  Graf Ludwig II. von Württemberg Graf Ludwig II. von Württemberg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Willibirg von Kirchberg. Willibirg wurde geboren in 1142; gestorben in 1179. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Prinzessin Rikissa von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Rikissa hatte mit Magnus von Dänemark (Schweden) wohl keine Kinder. Rikissa heiratete König Magnus von Dänemark, der Starke in 1127. Magnus wurde geboren in 1107; gestorben am 4 Jun 1134 in Fodevig im Südwesten von Skåne. [Familienblatt] [Familientafel] Rikissa heiratete Volodar Gļebovič am 1135 / 1136, und geschieden in 1145. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: König Sverker I. von Schweden, der Ältere . Sverker gestorben in cir 1156. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. |  Grossherzog Miezislaus III. (Mieszko) von Polen Grossherzog Miezislaus III. (Mieszko) von Polen Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III. (Jun 2018) Miezislaus heiratete Herzogin Elisabeth von Ungarn in cir 1140. Elisabeth (Tochter von König Béla II. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Helena (Jelena, Ilona) von Serbien) wurde geboren in 1128; gestorben in zw 1152 und 1153. [Familienblatt] [Familientafel]
Miezislaus heiratete Eudoxia von Kiew in cir 1154. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | Judith von Polen (Piasten) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Polen Familie/Ehepartner: Ladislaus (Laszlo) II. von Ungarn (von Kroatien). Ladislaus (Sohn von König Béla II. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Helena (Jelena, Ilona) von Serbien) wurde geboren in 1131; gestorben am 14 Jan 1163. [Familienblatt] [Familientafel]
Judith heiratete Markgraf Otto I. von Brandenburg (Askanier) in cir 1148. Otto (Sohn von Markgraf Albrecht I. von Brandenburg (von Ballenstedt) (Askanier), der Bär und Markgräfin Sophie von Winzenburg) wurde geboren in 1128; gestorben am 8 Jul 1184. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Agnes von Polen Familie/Ehepartner: Mstislaw II. von Kiew. Mstislaw (Sohn von Isjaslaw II. Mstislawitsch von Kiew (Rurikiden)) gestorben in 1170. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 59. | Herzog Kasimir II. von Polen (von Masowien) (Piasten), der Gerechte Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Helena von Ruthenia. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. |  Pribislawa Pribislawa Pribislawa heiratete Herzog Ratibor I. von Pommern (Greifen) in Datum unbekannt. Ratibor (Sohn von N N) gestorben am 7 Mai 1156; wurde beigesetzt in Kloster Grobe, Usedom. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. |  Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) Herzog Vladislav II. von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II. (Okt 2017) Vladislav heiratete Gertrud von Österreich (Babenberger) in 1140. Gertrud (Tochter von Leopold III. von Österreich (Babenberger), der Heilige und Prinzessin Agnes von Deutschland (von Waiblingen)) wurde geboren in cir 1120; gestorben am 8 Apr 1150. [Familienblatt] [Familientafel]
Vladislav heiratete Judith von Thüringen in 1153. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. |  Graf Ulrich von Berg Graf Ulrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berg_(Ehingen) Familie/Ehepartner: Adelheid (Udelhild) von Ronsberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. |  Bischof Heinrich von Berg Bischof Heinrich von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Berg |
| 64. |  Bischof Diepold von Berg Bischof Diepold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Diepold_von_Berg |
| 65. |  Bischof Manegold von Berg Bischof Manegold von Berg Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Manegold_von_Berg |
| 66. |  Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Bischof Otto II. von Berg (Schelklingen?) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._von_Berg |
| 67. |  Graf Ludwig III. von Spitzenberg (I. von Helfenstein) Graf Ludwig III. von Spitzenberg (I. von Helfenstein) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: http://www.die-helfensteiner.de/index.php/altvorderen/die-grafen.html Familie/Ehepartner: von Helfenstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 68. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Spitzenberg |
| 69. |  Markgraf Hermann V von Baden Markgraf Hermann V von Baden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Markgraf Hermann V. von Baden († 16. Januar 1243) war Titular-Markgraf von Verona und 1190 bis 1243 regierender Markgraf von Baden. Mit dem Zugewinn der Städte Pforzheim, Durlach und Ettlingen gelang ihm der Aufbau eines soliden Grundstocks für eine Territorialherrschaft. Hermann heiratete Pfalzgräfin Irmengard bei Rhein (von Braunschweig) in cir 1217. Irmengard (Tochter von Heinrich V. von Braunschweig (von Sachsen) (Welfen), der Ältere und Pfalzgräfin Agnes von Staufen) wurde geboren in cir 1200; gestorben am 24 Feb 1260. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. |  Markgraf Heinrich I von Baden Markgraf Heinrich I von Baden Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Baden-Hachberg) Familie/Ehepartner: Agnes von Urach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. |  Friedrich von Baden Friedrich von Baden |
| 72. |  Jutta von Baden Jutta von Baden |
| 73. |  Bertha von Baden Bertha von Baden |
| 74. |  Gertrud von Baden Gertrud von Baden Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Baden Gertrud heiratete Albert II. (Albrecht) von Dagsburg (Etichonen) in cir 1180. Albert (Sohn von Graf Hugo X. von Dagsburg (Etichonen)) gestorben in 1212. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 75. | Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Urach |
| 76. | Marguerite heiratete Swigger IV. von Gundeldingen in Datum unbekannt. Swigger (Sohn von Swigger III. von Gundelfingen) wurde geboren in 1179 in Gundelfingen, Münsingen, DE; gestorben in 1231 in Gundelfingen, Münsingen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. |  Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) Graf Egino V. von Urach (von Freiburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Egino_V._(Urach) Familie/Ehepartner: Adelheid von Neuffen. Adelheid (Tochter von Graf Heinrich I. von Neuffen und Adelheid von Winnenden) gestorben in 1248. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 78. | Jolanthe heiratete Graf Ulrich III. von Neuenburg in 1202. Ulrich (Sohn von Graf Ulrich II. von Neuenburg und Baronin Berta (Berthe) von Grenchen (de Granges)) wurde geboren in cir 1175; gestorben in 1225. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 79. |
| 80. |
| 81. | Familie/Ehepartner: Markgraf Heinrich I von Baden. Heinrich (Sohn von Markgraf Hermann IV von Baden und Markgräfin Bertha von Tübingen) wurde geboren in vor 1190; gestorben am 2 Jul 1231; wurde beigesetzt in Kloster Tennenbach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 82. | Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Friedrich II. von Pfirt. Friedrich (Sohn von Graf Ludwig II. von Pfirt und Agnes von Saugern) gestorben in zw 1231 und 1233. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 83. |  Graf Werner von Kyburg (Kiburg) Graf Werner von Kyburg (Kiburg) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Nahm am fünften Kreuzzug Kaiser Friedrichs II. teil, fiel bei Akkon und wurde nach der Wiedereroberung von Jerusalem von den Johanniterrittern dort beigesetzt. Familie/Ehepartner: Herzogin Alix Berta von Lothringen. Alix (Tochter von Herzog Friedrich II. von Lothringen (von Bitsch) und Gräfin Agnes von Bar) gestorben in 1242. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. |  Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg) Gräfin Heilwig von Kyburg (Kiburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Albrecht IV. von Habsburg, der Weise . Albrecht (Sohn von Rudolf II. von Habsburg, der Gütige und Agnes von Staufen) wurde geboren in cir 1188; gestorben am 25 Nov 1239 in Askalon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. |  von Kyburg (Kiburg) von Kyburg (Kiburg) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Graf Ludwig von Württemberg. Ludwig (Sohn von Graf Ludwig II. von Württemberg und Willibirg von Kirchberg) gestorben in cir 1228/36. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. |  Herzog Konrad I. von Teck Herzog Konrad I. von Teck Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Teck) Familie/Ehepartner: von Henneberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. |  Ita von Pfullendorf-Bregenz Ita von Pfullendorf-Bregenz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Pfullendorf Ita heiratete Albrecht III. (Albert) von Habsburg, der Reiche in 1164. Albrecht (Sohn von Graf Werner II. (III.) von Habsburg und Ida (Ita) von Starkenberg) gestorben am 10 Feb 1199. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. |  von Ronsberg von Ronsberg Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Rudolf II. von Tübingen. Rudolf (Sohn von Pfalzgraf Rudolf I. von Tübingen und Gräfin Mechthild von Gießen) gestorben am 1 Nov 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. |  Adelheid (Udelhild) von Ronsberg Adelheid (Udelhild) von Ronsberg Familie/Ehepartner: Graf Ulrich von Berg. Ulrich (Sohn von Graf Diepold von Berg-Schelklingen und Gisela von Andechs (von Diessen)) wurde geboren in 1166; gestorben in 1205. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 90. |  Graf Burkhard V. von Hohenberg Graf Burkhard V. von Hohenberg Notizen: Zitat aus: Familie/Ehepartner: Pfalzgräfin Mechthild von Tübingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 91. |  Engino von Aichelberg Engino von Aichelberg Notizen: Name: Engino heiratete von Otterswang in Datum unbekannt. wurde geboren in cir 1190. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. |  Graf Berthold I von Graisbach (von Lechsgemünd) Graf Berthold I von Graisbach (von Lechsgemünd) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Adelheid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. |  Graf Ludwig von Württemberg Graf Ludwig von Württemberg Familie/Ehepartner: von Kyburg (Kiburg). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. |  Graf Hartmann I. von Württemberg Graf Hartmann I. von Württemberg Notizen: Name: Familie/Ehepartner: von Veringen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. | 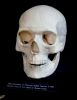 Königin Sophia von Dänemark (von Minsk) Königin Sophia von Dänemark (von Minsk) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Sophia hatte mit Waldemar I. sieben Kinder. Familie/Ehepartner: König Waldemar I. von Dänemark, der Grosse . Waldemar (Sohn von Knud Lavard von Dänemark und Ingeborg von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren am 14 Jan 1131; gestorben am 12 Mai 1182 in Vordingborg. [Familienblatt] [Familientafel]
Sophia heiratete Landgraf Ludwig III. von Thüringen (Ludowinger) in Datum unbekannt. Ludwig (Sohn von Landgraf Ludwig II. von Thüringen, der Eiserne und Judith (Jutta Claricia) von Schwaben (von Thüringen)) wurde geboren in 1151/1152; gestorben am 16 Okt 1190 in Überfahrt nach Zypern; wurde beigesetzt in Georgenkirche, Eisenach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 96. |  Prinzessin Ludomilla von Polen Prinzessin Ludomilla von Polen Notizen: Ludomilla und Friedrich I. hatten 13 Kinder. Ludomilla heiratete Herzog Friedrich I. (Ferri) von Lothringen (von Bitsch) in vor 1167. Friedrich (Sohn von Herzog Matthäus I. von Lothringen und Bertha von Schwaben) wurde geboren in cir 1143; gestorben in 1207. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. |  Elisabeth (Elżbieta) von Polen Elisabeth (Elżbieta) von Polen Elisabeth heiratete Konrad II. von Groitzsch (von Lausitz) in 1180/1181. Konrad wurde geboren in nach 12 Sep 1159; gestorben am 6 Mai 1210. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Soběslav II. von Böhmen. Soběslav wurde geboren in cir 1128; gestorben am 29 Jan 1180. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 98. |  Judith von Polen Judith von Polen Judith heiratete Herzog Bernhard III. von Sachsen (von Ballenstedt) (Askanier) in vor 1175. Bernhard (Sohn von Markgraf Albrecht I. von Brandenburg (von Ballenstedt) (Askanier), der Bär und Markgräfin Sophie von Winzenburg) wurde geboren in 1140; gestorben am 9 Feb 1212 in Bernburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 99. |  Anastasia von Polen Anastasia von Polen Anastasia heiratete Herzog Bogislaw I. von Pommern (Greifen) in 1177. Bogislaw (Sohn von Fürst Wartislaw I. von Pommern (Greifen) und Ida) wurde geboren in cir 1130; gestorben am 18 Mrz 1187 in Sosnitza bei Altwarp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. | Maria von Ungarn |
| 101. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._(Brandenburg) Familie/Ehepartner: Adelheid (Ada?) von Holland?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 102. | Graf Heinrich von Brandenburg (Askanier) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Gardelegen |
| 103. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Polen) Familie/Ehepartner: Agathe von Halytsch-Wolhynien. Agathe gestorben in nach 1247. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. | Anastasia von Polen (von Masowien) (Piasten) Anastasia heiratete Grossfürst Wsewolod IV. in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 105. | Margaretha von Schlawe Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margaretha_von_Schlawe Margaretha heiratete Graf Bernhard I. von Ratzeburg (Badwiden) in vor 1162. Bernhard gestorben in 1195. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. |  Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) Bedřich (Friedrich) von Böhmen (Přemysliden) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_(Böhmen) (Okt 2017) Bedřich heiratete Elisabeth von Ungarn in nach 1157. Elisabeth (Tochter von König Géza II von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Euphrosina Mstislawna von Kiew (Rurikiden)) wurde geboren in 1114 /1145; gestorben in 1185. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. |  König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) König Ottokar I. Přemysl von Böhmen (Přemysliden) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_I._Přemysl (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Adelheid von Meissen. Adelheid (Tochter von Markgraf Otto von Meissen (Wettiner) und Markgräfin Hedwig von Brandenburg (von Ballenstedt)) wurde geboren in nach 1160; gestorben am 2 Feb 1211 in Meissen, Sachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Konstanze von Ungarn. Konstanze (Tochter von König Béla III. von Ungarn (von Kroatien) (Árpáden) und Königin Agnès von Châtillon) wurde geboren in zw 1177 und 1181; gestorben am 04/05 Dez 1240 in Předklášteří. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 108. |  Graf Diepold von Kersch (von Berg) Graf Diepold von Kersch (von Berg) Notizen: Geburt: Diepold heiratete Wilipirg von Aichelberg in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. |  Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Graf Heinrich III. von Berg (I. von Burgau) Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Burgau Familie/Ehepartner: Adelheid von Württemberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 110. | Anderer Ereignisse und Attribute:
Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Spitzenberg_(Kuchen) Familie/Ehepartner: von Ravenstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|